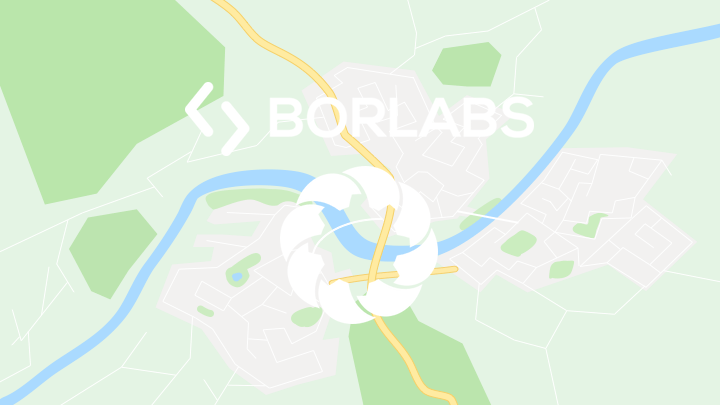Ihre Rechtsanwälte in München für Erbrecht und Familienrecht mit Kompetenz in Mediation.
Herzlich willkommen in unserer Kanzlei. In unserer Kanzlei fällt Ihre Wahl auf kompetente Rechtsanwälte, deren größtes Ziel Ihre Zufriedenheit ist. Als Anwältinnen aus dem Raum München legen wir großen Wert darauf, auf die individuelle Situation unserer Mandanten einzugehen und engagiert für Ihre Belange einzustehen. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten für Erbrecht München und Familienrecht München, wenn Ihnen eine vertrauensvolle Kooperation und Serviceleistungen in höchster Qualität am Herzen liegen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Mischung aus Kompetenz, Engagement, Qualität und Vertrauen eine wichtige Grundlage zur Bearbeitung Ihres Mandats ist.
Bestmögliche Lösungen erarbeiten: Mit Ihren Rechtsanwälten in München
Jede in unserer Kanzlei in München tätige Anwältin hat sich bewusst auf das Erbrecht sowie das Familienrecht spezialisiert. Unser Erfahrungsreichtum sowie unser umfassendes Fachwissen helfen dabei, in enger Zusammenarbeit mit Ihnen stets die bestmöglichen Lösungen zu erarbeiten. Damit Ihnen jeder Fachanwältin und jeder Fachanwalt unserer Kanzlei aus München den bestmöglichen Service bietet, arbeiten wir eng mit anderen Kanzleien zusammen. Diese Kooperation ist eine wichtige Grundlage dafür, um Sie auch außerhalb unserer spezialisierten Rechtsgebiete kompetent zu unterstützen. Bei Bedarf bieten jede Anwältin und jeder Anwalt unserer Kanzlei aus München auch eine Zusammenarbeit mit renommierten Notaren, Steuerberatern und Psychologen an.
CLAUDIA SEIDL
Fachanwältin für Erbrecht
Fachanwältin für Familienrecht
„Als Anwältin erfahre ich oft sehr persönliche Dinge aus der Kindheit und Ehe meiner Mandanten. Sich dieses besonderen Vertrauens würdig zu erweisen, setzt neben der Professionalität auch Einfühlungsvermögen und Unvoreingenommenheit voraus.“
DR. VANESSA HOHENBLEICHER
Fachanwältin für Erbrecht
Fachanwältin für Familienrecht
„Im Familien- und Erbrecht trifft man Menschen oft in Extremsituationen an. Die fachliche Betreuung steht für uns an oberster Stelle, aber wir wollen die Menschen auch als Problemlöser begleiten. Dazu ist es wichtig, dass man die emotionalen Aspekte nicht aus dem Blick verliert.“
KATHARINA MIRZ
Fachanwältin für Familienrecht
Fachanwältin für Erbrecht
Master of Mediation
„Mir ist wichtig, dass die Parteien mit dem Ergebnis zufrieden sind und weiterhin gut miteinander kommunizieren können. Dass sie gut begleitet aus der Krise herausgehen, das ist für mich der größte Erfolg.“
Ihr kompetenter Fachanwalt für Familienrecht München
Als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt für Familienrecht München beraten wir Sie gerne vollumfänglich zu allen familienrechtlichen Angelegenheiten. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung. Wir sind stets bestrebt, die bestmögliche Lösung für Ihre Situation zu finden. Beispielsweise sind wir als Fachanwältinnen und Fachanwälte aus München die richtigen Ansprechpartner für Sie, falls Sie Unterstützung bei der Erstellung eines Ehevertrags benötigen. Wir erarbeiten mit Ihnen ein Vertragskonzept, das Ihrer persönlichen Situation angepasst ist. Auch im Falle einer Trennung oder Scheidung sind wir für Sie da, um rechtliche Klarheit zu schaffen. Unsere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte aus München unterstützen Sie nicht nur dabei, geregelte Strukturen zu schaffen, sondern auch die Kommunikation zwischen allen Beteiligten aufrechtzuerhalten.
Klare Strukturen: Mit einer Anwältin oder einem Anwalt für Erbrecht München
Mit umfassenden Beratungen rund ums Thema Erbrecht in München möchten wir Ihnen Ihre Sorgen nehmen. Dank unserer Erfahrung sowie dem nötigen Einfühlungsvermögen erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die für alle Beteiligten akzeptabel sind. Die Funktion unserer Rechtsanwälte aus München als sachliche Berater besteht darin, unterschiedliche Interessen zu beleuchten und neue Perspektiven zu eröffnen. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Gestaltung eines Testaments oder eines Erbvertrags.
UNSERE SCHWERPUNKTE
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte aus München: Ihr Spezialist für Mediation
Unsere Fachanwälte und Fachanwältinnen aus München bieten Ihnen auch Mediationen an, um Konflikte strukturiert, konstruktiv und außergerichtlich zu lösen. Wir offerieren Ihnen informelle und außergerichtliche Lösungsprozesse für Ihre individuelle Konfliktbewältigung. Eine außergerichtliche Streitbeilegung durch eine erfahrene Anwältin oder einen Anwalt aus München erzielt häufig ein sehr zufriedenstellendes Resultat. Zugleich hat sich die Mediation als kostengünstigere Variante einer Streitbeilegung bewährt.
Drei Rechtsanwältinnen in München für Familienrecht und Erbrecht
Wenden Sie sich an unsere drei Rechtsanwältinnen in München, wenn Sie bei der Betreuung und Begleitung Ihrer juristischen Probleme keine Kompromisse eingehen möchten. Unsere Anwältinnen aus München überzeugen nicht nur mit Kompetenz und dem nötigen Einfühlungsvermögen. Falls erforderlich, stehen wir jeweils als Fachanwältinnen für Erbrecht München und Familienrecht München mit aller Entschlossenheit für Ihre Belange ein. Gern möchten wir Sie von unserer Expertise im Umgang mit Familienrecht München sowie Erbrecht München überzeugen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann kontaktieren Sie uns telefonisch oder per Mail. Auf Ihren Wunsch vereinbaren wir ebenfalls gern einen Termin für ein erstes Informations- und Beratungsgespräch.